Was bedeuten Tiergesundheit und Tierwohl für das Schwein?
Tierwohl und Tiergesundheit sind wichtige Themen. Allen voran für uns Landwirte, denn ohne gesunde Nutztiere, die sich wohlfühlen, können wir nicht arbeiten. Das Schwein, zum Beispiel, ist eines der ältesten Nutztiere der Menschheit und die Schweinehaltung eine der wichtigsten Säulen in der deutschen Landwirtschaft. Nach einer Definition der Begriffe Tierwohl und Tiergesundheit zeigen wir Dir am Beispiel des Schweins, wie wir Tiergesundheit und Tierwohl umsetzen und wie Du als Verbraucher Tierwohl beeinflussen kannst.
Was bedeuten die Begriffe Tiergesundheit und Tierwohl?
Tiergesundheit:
Es ist die zentrale Aufgabe eines jeden Halters ein Tier gesund zu halten. Dies verlangt gute Haltungsbedingungen sowie eine art- und altersgerechte Fütterung. Zudem gehören die Vorbeugung von Krankheiten und ihre Behandlung mit zugelassenen Medikamenten zur Tiergesundheit.
Tierwohl:
Tierwohl geht über Tiergesundheit hinaus und verlangt eine Tierhaltung, die sich an den biologischen Bedürfnissen der jeweiligen Art orientiert und in der das Tier seine natürlichen Verhaltensweisen ausleben kann. Tierwohl umfasst zudem die Freiheit von Hunger und Durst, Leiden und Unbehagen durch die Umgebung.

Tiergesundheit in der Schweinehaltung
Zu den Prioritäten von Schweinehaltern gehört es die Gesundheit der Schweine und somit auch eine gute Fleischqualität für den Menschen sicherzustellen. Dazu ergreifen sie auch präventive Maßnahmen wie Impfungen oder setzen, bei Bedarf, medikamentöse Behandlungen ein.
Impfungen:
Die wichtigste vorbeugende Maßnahme gegen Krankheiten bei Schweinen sind Impfungen. Diese werden routinemäßig in der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft durchgeführt und schützen Schweine wirksam vor den Infektionskrankheiten Circovirose und Mycoplasmose. Es gibt jedoch nicht gegen alle Bakterien und Erreger Impfstoffe, sodass zum Teil auch andere Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Stallhaltung:
Aus Gründen des Seuchenschutzes sehen gesetzliche Verordnungen vor, dass Schweine vor Kontakten mit Menschen und Tieren geschützt werden müssen. In der Freilandhaltung kommen die Tiere leicht in Berührung mit anderen Wild- oder Haustieren, die Infektionen übertragen können. Ein besonders hohes Risiko stellt die Schweinepest dar, die durch den direkten Kontakt mit Wildschweinen, aber auch durch schmutzige Stiefel, Geräte oder andere Tiere übertragen werden kann. Die Schweinepest ist nicht auf den Menschen übertragbar, endet für die Mehrheit der Schweine jedoch tödlich. Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren und den Anforderungen der Seuchenvorsorge zu entsprechen, werden Schweine in der Regel in geschlossenen, gut durchlüfteten Ställen gehalten. In der biologischen Landwirtschaft haben Schweine Auslauf an der frischen Luft, jedoch aufgrund des Infektionsrisikos selten im Freiland. Zudem gelten strenge Hygienemaßnahmen für diejenigen, die die Ställe betreten.
Behandlung mit Antibiotika:
Die vorbeugende Behandlung von Schweinen mit Antibiotika ist gesetzlich verboten. Ist ein Tier jedoch erkrankt, muss schnell gehandelt werden. In der Gruppenhaltung, wie sie in der Schweinemast vorgeschrieben ist, können sich Erreger schnell verbreiten, sodass es notwendig sein kann, einzelne Gruppen oder gar den gesamten Bestand mit Antibiotika zu behandeln. Diese müssen immer durch einen Tierarzt verschrieben werden, der die Behandlung beobachtet.

Tierwohl im Schweinestall
Um Tierwohl gewährleisten zu können, ist es wichtig, das Tier und seine individuellen Vorlieben zu kennen. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe, die Schweine halten, werden familiär geführt und von Generation zu Generation übergeben. Viele der heute tätigen Schweinebauern sind mit der Haltung der Tiere großgeworden und kennen sie gut. Dieses Wissen erlaubt es den Landwirten, auf die biologischen Bedürfnisse der Tiere einzugehen und schnell zu erkennen, wenn ein Tier sich nicht wohlfühlt.
Gruppenhaltung:
Schweine sind soziale Tiere, die in Gruppenverbänden leben. Deshalb ist die Haltung von Schweinen in Gruppen gesetzlich vorgeschrieben. Einzig trächtige Sauen werden kurz vor der Geburt der Ferkel einzeln in sogenannte Abferkelbuchten gebracht. In jeder Gruppe von Schweinen entwickelt sich eine Rangfolge, die – sobald die Gruppe sich verändert – neu ausgefochten wird. Deshalb haben Schweine in neu zusammengestellten Gruppen in den ersten Tagen häufig Kratzer oder leichte Verletzungen. Wenn sich die Rangordnung einmal formiert hat, fressen und ruhen die Schweine friedlich zusammen und pflegen sich gegenseitig die Haut.
Beschäftigung:
Schweine sind neugierige, aktive Tiere. Während Ferkel gerne mit ihren Geschwistern spielen, brauchen ältere Mastschweine andere Formen der Beschäftigung. Bürsten und Scheuerklötze sowie bewegliche Gegenstände (Bälle, Strohballen, Ketten) bieten zum einen Beschäftigung, erhöhen aber auch das körperliche Wohlbefinden. Beschäftigungsmaterialien im Stall sind keine freiwillige Maßnahme, sondern im Tierschutzgesetz festgeschrieben.
Temperatur:
Schweine besitzen keine Schweißdrüsen und können ihre Körpertemperatur nur bedingt beeinflussen. Bei Ferkeln kann es bei Temperaturen unter 25 Grad Celsius zu Unterkühlung kommen, ausgewachsene Schweine bevorzugen eine Temperatur von 18 Grad Celsius. Deshalb sind moderne Schweineställe klimaoptimiert und passen sich den Bedürfnissen der Schweine je nach Alter und Wetter an. Besonders die perforierten Böden aus Beton bieten im Sommer gute Kühl- und Durchlüftungsmöglichkeiten.
Futter:
Schweine sind Allesfresser und brauchen in ihren Wachstumsphasen energiereiches Futter. Da ranghöhere Tiere sich vor rangniedrigeren am Futtertrog bedienen, ist ein ausreichendes Futterangebot wichtig. Moderne Fütterungsanlagen bieten den Schweinen Futter in unterschiedlicher Konsistenz – mal mit Wasser zu einem Brei vermengt oder als Trockenfutter.
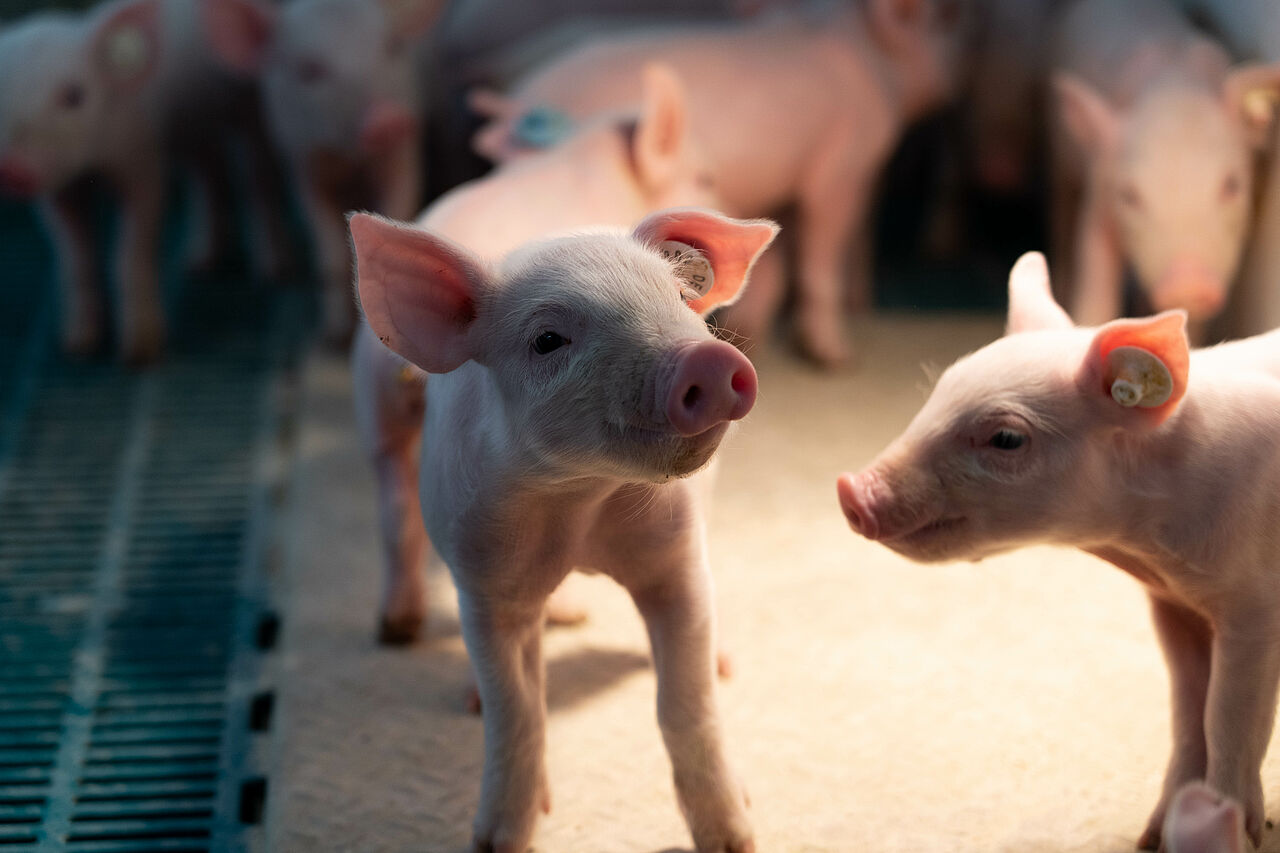

Tierwohl weiter verbessern
Es ist das Anliegen der Halter Tierwohl und Tiergesundheit durch eine tiergerechte Haltung sicherzustellen. Verschärfungen im Tierschutzrecht wie auch freiwillige Maßnahmen tragen dazu bei, dass dem Gedanken des Tierwohls immer stärkere Bedeutung zukommt. Die vielen technologischen Möglichkeiten geben den Landwirten mehr Zeit zur Pflege der Tiere.
Wie Du zum Tierwohl beitragen kannst
Wenn Du Dich für mehr Tierwohl einsetzen und es fördern willst, kannst Du durch Deinen Einkauf einen Beitrag leisten. Tierwohl-Labels zeigen an, unter welchen Bedingungen das Nutztier, von dem Du Dein Fleisch kaufst, gelebt hat – ob es beispielsweise mehr Platz hatte als im Tierschutzgesetz vorgesehen. Durch die Wahl Deines Fleisches und anderer tierischer Produkte kannst Du als Verbraucher mitentscheiden, wie Nutztiere heute leben und wie sie zukünftig leben sollen.







